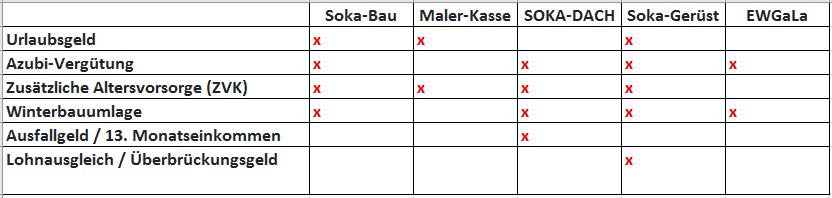Was versteht man unter einer doppelten Haushaltsführung?
Eine doppelte Haushaltsführung bezeichnet eine Konstellation, in der ein Arbeitnehmer aus beruflichen Gründen neben seinem Haupthaushalt einen weiteren Haushalt hat.
Entgegen der oftmals getätigten Aussagen stellen die Regelungen des Gesetzgebers im Einkommensteuergesetz (EStG) zur doppelten Haushaltsführung keine besondere Möglichkeit des Werbungskostenabzugs für Arbeitnehmer, sondern eine Einschränkung des Werbungskostenabzugs dar. Jedoch stehen dieser Einschränkung verfassungsrechtliche Bedenken gegenüber, so dass es in den letzten Jahren und Jahrzehnten einen umfangreichen Katalog an Gerichtsentscheidungen gegeben hat, die die Regelungen des Gesetzgebers anhand der Lebenswirklichkeiten vieler Steuerpflichtiger ausgelegt haben.
Aufgrund der zunehmenden Mobilität der Arbeitnehmer gewinnen die Regelungen und Gerichtsurteile zur doppelten Haushaltführung an praktischer Bedeutung für viele Steuerpflichtige und deren Familien.
Wo findet man im Gesetz die Regelungen zur doppelten Haushaltsführung?
Die gesetzliche Regelung zur doppelten Haushaltsführung findet sich in § 9 Abs. 1 Nr. 5 EStG und § 4 Abs. 5 Nr. 6a EStG.
Gibt es ein BMF-Schreiben, das die doppelte Haushaltsführung umfassend behandelt?
Mit BMF-Schreiben vom 25. November 2020 hat das Bundesministerium der Finanzen den bis dahin gültigen Erlass zur steuerlichen Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern überarbeitet. Zwar beschäftigt sich der neue Erlass nicht hauptsächlich mit den steuerlichen Aspekten der doppelten Haushaltsführung oder erläutert diese gar umfassend, jedoch gibt es einige Begriffsbestimmungen und Grundsätze aus dem Reisekostenrecht, die bei einer doppelten Haushaltsführung analog anzuwenden sind (z.B. Definition einer Tätigkeitsstätte). Außerdem widmet der Erlass speziell einzelne Abschnitte der doppelten Haushaltsführung.
Was sind die Voraussetzungen der doppelten Haushaltsführung?
In diversen Artikeln und Publikationen werden entweder 3, 4 oder gar noch mehr Voraussetzungen genannt, die zur steuerlichen Berücksichtigung der durch einen doppelten Haushalt verursachten Mehraufwendungen vorliegen müssen. Dieser Artikel orientiert sich an den im Gesetz definierten Voraussetzungen.
Es müssen nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 EStG folgende Voraussetzungen erfüllt werden:
- Berufliche Veranlassung,
- Unterhalten eines eigenen Hausstands (= Hauptwohnung) außerhalb des Arbeitsortes sowie
- Unterhalten einer Wohnung (=Zweitwohnung) am Arbeitsort.
Nur wenn alle 3 Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sind, werden die Mehraufwendungen für die doppelte Haushaltsführung durch das Finanzamt anerkannt und es kann zu einer Steuererstattung kommen. In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Voraussetzungen näher erläutert.
Hinweis:
Im Gesetz sowie in sonstigen relevanten Verlautbarungen findet sich meist der Ausdruck „Ort der ersten Tätigkeitsstätte“. Dieser Ausdruck bezeichnet den Ort bzw. Arbeitsplatz, an dem der Arbeitnehmer regelmäßig zur Erbringung seiner Arbeit tätig wird. Aus Vereinfachungsgründen wird dieser Ort im Folgenden als „Arbeitsplatz“ bezeichnet.
Wann genau liegt eine berufliche Veranlassung für eine doppelte Haushaltsführung vor?
Aus den Lohnsteuerrichtlinien sowie der Rechtsprechung ist zu entnehmen, dass beim Bezug einer Zweitwohnung aufgrund einer Abordnung bzw. Versetzung oder beim Antritt eines neuen Arbeitsplatzes eindeutig eine berufliche Veranlassung gegeben ist. Die Zweitwohnung wird dann wegen des schnelleren und sichereren Erreichens des Arbeitsplatzes errichtet, also aus beruflicher Veranlassung.
Entscheidend ist einzig, dass der Zweithaushalt am Ort des Arbeitsplatzes aus beruflichen Gründen bezogen wurde. Daher ist es auch unschädlich, wenn nachrangig auch private Gründe für den Bezug dieser Zweitwohnung bestehen. Der BFH hat sogar entschieden, dass eine Verlagerung des Familienwohnsitzes vom Ort des Arbeitsplatzes bei gleichzeitigem Bezug einer Zweitwohnung zum Aufsuchen des Arbeitsplatzes einer beruflichen Veranlassung nicht widerspricht und die Mehraufwendungen für die Zweitwohnung damit steuerlich anzuerkennen sind.
Hervorzuheben ist auch die Rechtsprechung des BFH, nach der bei einer Heirat zweier Menschen, die an verschiedenen Orten wohnen, eine berufliche Veranlassung zum Beibehalten der Wohnungen gegeben ist und in diesem Zusammenhang auch die Wahl einer der beiden Wohnung als Familienheim dem nicht entgegensteht.
Welche Anforderungen werden an die Hauptwohnung außerhalb des Ortes des Arbeitsplatzes gestellt?
Das zentrale Kriterium an die Hauptwohnung außerhalb des Arbeitsorts, dass dieser den Lebensmittelunkt des Arbeitnehmers darstellt. Für die Frage, ob bei einer Wohnung dann wirklich der Lebensmittelpunkt der Lebensinteressen eines Arbeitnehmers vorliegt, gibt es keine durch den Gesetzgeber oder die Rechtsprechung definierten Voraussetzungen; es ist stattdessen (durch das Finanzgericht als Tatsacheninstanz) durch eines Gesamtwürdigung der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei können u.a. folgende Aspekte in die Beurteilung einfließen: soziale und familiäre Verhältnisse, Entfernung zwischen den beiden Wohnungen, Ausstattung der Wohnungen, Dauer des Aufenthalts in der Hauptwohnung, melderechtliche Verhältnisse, Beschäftigungsdauer, Vereinszugehörigkeiten.
Ein bedeutendes Indiz für das Vorliegen des Mittelpunkts der Lebensinteressen ist neben der finanziellen Beteiligung (näheres weiter unten im Abschnitt) die persönliche Mitwirkung des Arbeitnehmers. Der BFH sieht eine persönliche Mitwirkung bei einem Einfluss, der das (gemeinsame) Leben in der Wohnung nachhaltig prägt. Hierbei können auch die Anwesenheitszeiten bzw. die Anzahl der Heimfahrten eine wichtige Rolle spielen.
Im Rahmen einer Gesetzesüberarbeitung hat der Gesetzgeber die Voraussetzungen für das Vorliegen einer Hauptwohnung außerhalb Arbeitsorts nach und nach verschärft und verlangt seit dem Veranlagungszeitraum 2014 neben dem „Innehaben einer Wohnung“ auch explizit eine „finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung“.
Hinsichtlich des „Innehabens einer Wohnung“ fordert das Gesetz nicht, dass die Hauptwohnung des Arbeitnehmers in dessen (alleinigem) Eigentum steht; eine Nutzung der Wohnung aufgrund Mietvertrags, aber auch sonstige Nutzungsmodelle sind möglich. Notwendig ist nur, dass er die Wohnung aus eigenem Recht (bzw. gemeinsam mit dem Ehepartner oder einem Mitbewohner) nutzt.
Die früher gängige Praxis, dass einem Arbeitnehmer lediglich ein unentgeltlich bei seinen Eltern zur Verfügung stehendes (Kinder-)Zimmer oder auch eine unentgeltlich überlassene Wohnung als Hauptwohnung dient, wird steuerlich nicht mehr als doppelte Haushaltsführung anerkannt. Seit dem Veranlagungszeitraum 2014 wurde explizit eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung durch den Arbeitnehmer als Bedingung im Gesetz verankert. Eine derartige finanzielle Beteiligung muss über Bagatellbeträge hinausgehen. Ab einer Höhe von 10% der monatlich regelmäßig anfallenden Kosten (z.B. Miete samt Nebenkosten, Lebensmittel sowie sonstige Dinge des täglichen Bedarfs) erkennt das Finanzamt die finanzielle Beteiligung durch Barleistungen an. Eine finanzielle Beteiligung bei weniger als 10% führt nicht notwendigerweise zu einem Versagen des Werbungskostenabzugs; in diesem Fall wäre eine (zusätzlich) auf alternativem Weg erfolgte finanzielle Beteiligung nachzuweisen. Ehegatten oder Lebenspartner profitieren von der Regelung, dass bei Vorliegen der Steuerklassen 3, 4 oder 5 kein Nachweis über eine finanzielle Beteiligung erbracht werden muss.
Auf welchem Weg die finanzielle Beteiligung erfolgt, liegt in der Wahl des Arbeitnehmers; so ist neben der Zahlung von Geldbeträgen die Beteiligung auch über die Anschaffung von Gegenständen oder die Übernahme von Kosten möglich. Die Herkunft der Mittel ist dabei irrelevant; so hat der BFH in einem Urteil selbst eine Beteiligung aus erhaltenen Kindergeldzahlungen erlaubt.
Hinweis:
Die Höhe der finanziellen Beteiligung als auch der Durchführungsweg (bar, Überweisung, Übernahme von Kosten etc.) sollten genau dokumentiert werden. Dabei sollte die Bagatellgrenze in Höhe von 10% deutlich überschritten werden; daher sollte eine genaue Berechnung der Gesamtkosten der Hauptwohnung angelegt werden, die sämtliche Kostenbestandteile umfasst.
Was gilt für die Zweitwohnung am Arbeitsort?
Der Bezug einer Wohnung am Arbeitsort findet meist statt, um den täglichen Weg zur Arbeit zu vereinfachen bzw. zu verkürzen – sofern das tägliche Pendeln von der Hauptwohnung nicht zumutbar ist. Bei einer Zweitwohnung, die der doppelten Haushaltsführung dienen soll, erwartet das Finanzamt daher eine bestimmte Nähe zum Arbeitsplatz. Es liegen aus diesem Grund viele Gerichtsentscheidungen vor, die sich dem Thema gewidmet haben, welche Entfernung eine Zweitwohnung zum Arbeitsplatz noch maximal haben kann, um als Zweitwohnung steuerlich anerkannt zu werden. So wurde bspw. entschieden, dass sich die Wohnung nicht in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz befinden muss, sondern auch eine Zweitwohnung mit einer Fahrtzeit von einer Stunde den Anforderungen genügt. In der Gesetzesbegründung im Rahmen der Überarbeitung von § 9 EStG hat der Gesetzgeber angeführt, dass vereinfachend von einer Zweitwohnung ausgegangen werden kann, wenn der Weg von der Zweitwohnung zum Arbeitsplatz weniger als die Hälfte der Entfernung der kürzesten Straßenverbindung zwischen der Hauptwohnung beim Mittelpunkt der Lebensinteressen und dem Arbeitsplatz beträgt.
Neben der Entfernung zur ersten Tätigkeitstätte ist auch die Ausgestaltung und Beschaffenheit der Zweitwohnung selbst ein wichtiges Kriterium, wenn es um die steuerliche Anerkennung geht. Die Zweitwohnung muss dem Arbeitnehmer ständig zur Nutzung zur Verfügung stehen, wodurch bspw. Das Übernachten in wechselnden Hotels nicht zum Werbungskostenabzug berechtigt. Steht ein Hotelzimmer dem Arbeitnehmer jedoch dauerhaft zur Verfügung, wird es steuerlich anerkannt.
Außerdem muss sich die Wohnung am Arbeitsort klar von der Hauptwohnung abgrenzen, der den Mittelpunkt der Lebensinteressen darstellt. Entwickelt sich die Zweitwohnung gar im Zeitverlauf zum Mittelpunkt der Lebensinteressen, liegt dadurch keine steuerlich anzuerkennende doppelte Haushaltsführung (mehr) vor.
Welche Kosten fallen unter „notwendige Mehraufwendungen“?
Unter den sonstigen Mehraufwendungen sind insbesondere Wohnungskosten, Fahrtkosten bzw. Familienheimfahrten sowie Verpflegungsmehraufwendungen zu verstehen. Neben diesen Kostenarten können aber auch andere Kosten steuermindernd berücksichtigt werden.
Allen Kosten, die im Rahmen der doppelten Haushaltsführung angesetzt werden können, ist gemeinsam, dass sie nicht unangemessen hoch sein dürfen. Dieser Grundsatz geht aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung des BFH hervor.
In welcher Höhe sind die Kosten für eine Wohnung von der Steuer absetzbar?
Die Kosten für die Zweitwohnung sind bis zu einem Betrag von maximal EUR 1.000 pro Monat von der Steuer absetzbar. Dieser Höchstbetrag wurde ab dem Veranlagungszeitraum 2014 im Gesetz verankert. Es handelt sich dabei um einen Monatsbetrag; nicht ausgeschöpfte Beträge eines Monats können in anderen Monaten des gleichen Veranlagungszeitraums genutzt werden, so dass in einzelnen Monaten ein Abzug von Unterhaltskosten von mehr als EUR 1.000 ermöglicht werden kann.
Dieser Höchstbetrag kann sich entweder auf ein Mietverhältnis beziehen, das der Zweitwohnung zugrunde liegt, oder aber auch auf Wohnungseigentum des Arbeitnehmers. Bei einem Mietverhältnis werden die Wohnungsmiete, Betriebskosten, Miete eines Kfz-Stellplatzes, Rundfunkbeitrag, Zweitwohnsitzsteuer oder auch die Kosten für die Pflege und Reinigung der Zweitwohnung durch den Höchstbetrag abgedeckt. Bei Wohnungseigentum fallen die Abschreibung, Finanzierungszinsen, Kosten für Instandhaltungen und Reparaturen sowie andere Nebenkosten in den Höchstbetrag rein.
Welche Fahrtkosten können im Rahmen der doppelten Haushaltsführung von der Steuer abgesetzt werden?
Bei der doppelten Haushaltsführung können die Kosten für folgende Fahrten steuerlich berücksichtigt werden:
- Erste und letzte Fahrt von der Hauptwohnung zum Arbeitsplatz und zurück,
- Familienheimfahrten sowie
- Fahrten zum Arbeitsplatz.
Für die Kosten der ersten und der letzten Fahrt können die dem Steuerpflichtigen tatsächlich entstandenen Fahrtkosten steuerlich geltend gemacht werden.
Als Familienheimfahrten können jede Woche eine Fahrt von der Hauptwohnung zum Arbeitsplatz und zurück geltend gemacht werden. Hier kommt eine Entfernungspauschale in Höhe von EUR 0,30 pro Entfernungskilometer zur Anwendung.
Wie andere Arbeitnehmer auch, kann der Steuerpflichtige für die Wege zwischen seiner Zweitwohnung die Entfernungspauschale in Höhe von EUR 0,30 pro Entfernungskilometer als Werbungskosten ansetzen. Diese Fahrtkosten sind unabhängig von der Beurteilung der doppelten Haushaltsführung durch das Finanzamt gewährt.
Wie werden Verpflegungsmehraufwendungen bei einer doppelten Haushaltsführung berücksichtigt?
Das Gesetz regelt in § 9 Abs. 4a Satz 12 EStG ausdrücklich den Abzug von Verpflegungsmehraufwendungen bei einer doppelten Haushaltsführung. Danach gelten die gesetzlichen Verpflegungspauschalen für eine Übergangszeit von 3 Monaten nach Begründung der doppelten Haushaltsführung.
Welche anderen Kosten können noch abgesetzt werden im Rahmen der doppelten Haushaltsführung bzw. sind zu beachten?
In die gesetzliche Höchstgrenze von EUR 1.000 für die Kosten der Unterkunft fallen nicht die Kosten für Einrichtungsgegenstände oder auch Hausrat, für die beide vereinfachend bei einer Summe von EUR 5.000 (inklusive Umsatzsteuer) eine Notwendigkeit unterstellt wird. Außerdem können noch Arbeitsmittel und Maklerkosten, die ebenfalls nicht unter die Höchstgrenze der Unterhaltskosten fallen, berücksichtigt werden.
Wie sieht es mit dem Abzug der Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer bei einer doppelten Haushaltsführung aus?
Die Geltendmachung einer doppelten Haushaltsführung schließt den Abzug der Werbungskosten für ein häusliches Arbeitszimmer grundsätzlich nicht aus. Es ist jedoch darauf zu achten, die beiden Themengebiete sauber voneinander zu trennen bzw. zu beurteilen. Außerdem dürfen entstandene Kosten nicht doppelt abgesetzt werden.
Wie hoch ist die Steuerersparnis durch die doppelte Haushaltsführung?
Die Steuerersparnis durch die doppelte Haushaltsführung hängt vom persönlichen Grenzsteuersatz ab. Die Steuerersparnis von Personen mit niedrigem Einkommen fällt damit geringer aus als die Steuerersparnis von Personen mit hohem Einkommen.
Sofern sich das zu versteuernde Einkommen vor Berücksichtigung der doppelten Haushaltsführung unter dem Grundfreibetrag von EUR 9.744 befindet, ergibt sich durch die doppelte Haushaltsführung überhaupt keine Steuerersparnis.
Beispiel 1
Ein Arbeitnehmer (Single) erzielt im Jahr 2021 ein zu versteuerndes Einkommen von EUR 9.500. Im Rahmen der doppelten Haushaltsführung entstehen ihm Werbungskosten in Höhe von EUR 4.000. Mit letztlich EUR 5.500 zu versteuerndem Einkommen im Jahr liegt der Arbeitnehmer, wie auch schon vor Ansatz der doppelten Haushaltsführung, unter dem Grundfreibetrag von EUR 9.744 und zahlt damit für 2021 keine Einkommensteuer. Der Ansatz der Werbungskosten für die doppelte Haushaltsführung hat damit also keine Auswirkung auf die Steuerbelastung gehabt bzw. zu keiner zusätzlichen Steuerersparnis geführt.
Steuerlich interessant wird die doppelte Haushaltsführung somit erst, wenn das Einkommen über dem Grundfreibetrag liegt.
Beispiel 2
Ein Arbeitnehmer (Single) erzielt im Jahr 2021 ein zu versteuerndes Einkommen in Höhe von EUR 50.000. Im Rahmen der doppelten Haushaltsführung entstehen ihm Werbungskosten in Höhe von EUR 5.500. Ohne die im Rahmen der doppelten Haushaltsführung anzusetzenden Werbungskosten zahlt der Arbeitnehmer EUR 11.994 Einkommensteuer. Nach Berücksichtigung der Werbungskosten für die doppelte Haushaltsführung beträgt die Steuerlast nur EUR 9.929. Die Steuerersparnis liegt also bei EUR 2.065.
Die maximal mögliche Steuerersparnis ergibt sich, wenn das Einkommen im Bereich der Reichensteuer (45% Grenzsteuersatz ab EUR 254.447 Einkommen bei ledigen Personen) liegt.
Beispiel 3
Ein Arbeitnehmer (Single) erzielt im Jahr 2021 ein zu versteuerndes Einkommen in Höhe von EUR 300.000. Im Rahmen der doppelten Haushaltsführung entstehen ihm Werbungskosten in Höhe von EUR 5.500. Ohne die im Rahmen der doppelten Haushaltsführung anzusetzenden Werbungskosten zahlt der Arbeitnehmer EUR 117.625 Einkommensteuer. Sofern die Person jedoch die Ehrenamtspauschale in Anspruch nimmt, beträgt die Steuerlast nur EUR 115.150. Die Steuerersparnis liegt also bei EUR 2.475 und damit nochmal deutlicher höher als in Beispiel 2. Die gesamte Steuerersparnis ergibt sich mathematisch durch Multiplikation der Höhe der Werbungskosten mit dem persönlichen Grenzsteuersatz (im Bereich der Reichensteuer: 45%): EUR 5.500 x 45% = EUR 2.475.
Gilt die doppelte Haushaltsführung für alle Arbeitnehmer?
Ja, die doppelte Haushaltsführung gilt sowohl für Angestellte als auch für Beamte.
Gilt die doppelte Haushaltsführung auch bei Einzelunternehmern
Ja, die doppelte Haushaltsführung gilt auch bei Einzelunternehmern. Über § 4 Abs. 5 Nr. 6a EStG sind die im Bereich der Arbeitnehmereinkünfte verankerten Regelungen auch für sämtliche Unternehmer im Sinne des Einkommensteuergesetzes analog anwendbar. Daher ist die doppelte Haushaltsführung nicht nur auf Einzelunternehmer, sondern bspw. auch für Kommanditisten einer GmbH & Co. KG relevant.
In manchen Artikeln zur doppelten Haushaltsführung wird angeführt, dass die doppelte Haushaltsführung
Gilt die doppelte Haushaltsführung auch für Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH oder UG?
Ja, die doppelte Haushaltsführung ist auch für Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH oder UG anwendbar. Gesellschafter-Geschäftsführer werden in der Sozialversicherung meist als Unternehmer behandelt, im Steuerrecht gelten Sie jedoch als Arbeitnehmer und beziehen Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit gemäß § 19 EStG. Aus diesem Grunde sind die für Arbeitnehmer geltenden Regelungen hinsichtlich der doppelten Haushaltsführung für Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH oder UG maßgebend.
Können auch alleinstehende Arbeitnehmer von den Regelungen zur doppelten Haushaltsführung profitieren?
Ja, auch alleinstehende Arbeitnehmer können die Werbungskosten einer doppelten Haushaltsführung von der Steuer absetzen.
Achtung:
In der Praxis gestaltet es sich bei alleinstehenden Arbeitnehmern meist schwieriger, die Voraussetzungen des Steuerrechts zur doppelten Haushaltsführung gegenüber dem Finanzamt nachzuweisen. Das Finanzamt äußert meist erhebliche Zweifel daran, dass der Lebensmittelpunkt nicht am Arbeitsort sein soll. Bei verheirateten Steuerpflichtigen — und insbesondere beim Vorliegen von Kindern – werden durch das Finanzamt meist keine Zweifel daran gestellt, dass der Lebensmittelpunkt am Familienwohnsitz besteht. Alleinstehende Arbeitnehmer sollten daher eine entsprechende Dokumentation anlegen, die auch Argumente dafür beinhaltet, dass der Lebensmittepunkt nicht Arbeitsort liegt.
Kann die doppelte Haushaltsführung auch neben einem EUR 450-Job begründet werden?
Prinzipiell schließen sich eine doppelte Haushaltsführung und ein EUR 450-Job nicht gegenseitig aus. Hintergrund ist, dass es durchaus möglich ist, neben einem „regulären“ Arbeitsverhältnis einen EUR 450-Job zu haben. Der EUR 450-Job bleibt weiterhin für den Arbeitnehmer steuerlich begünstigt, während im Rahmen des „regulären“ Arbeitsverhältnisses die Werbungskosten für die doppelte Haushaltsführung berücksichtigt werden.
Kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Kosten der doppelten Haushaltsführung steuerfrei ersetzen?
Ja, der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer die Kosten der doppelten Haushaltsführung steuerfrei ersetzen. Die gesetzliche Grundlage hierfür liefert § Nr. 16 EStG, der neben dem steuerfreien Ersatz von Reisekosten, Umzugskosten eben auch den steuerfreien Ersatz von Mehraufwendungen bei doppelter Haushaltsführung vorsieht.
Ohne die Verankerung der Regelung im Gesetz müssten die vom Arbeitgeber erstatteten Aufwendungen im Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens erst vom Arbeitnehmer versteuert werden, bevor er die zugehörigen Kosten bei Abgabe seiner Einkommensteuererklärung ansetzen könnte. Dies würde zu einem spürbaren Liquiditätsnachteil des Arbeitnehmers führen, da die entsprechende Steuererstattung erst mit zeitlichem Verzug nach Erlass des Steuerbescheids vereinnahmt werden könnte.
Der Katalog der Mehraufwendungen, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer steuerfrei erstatten kann, umfasst neben den Kosten der Zeitwohnung auch Fahrtkosten und Verpflegungsmehraufwendungen. Daneben sind auch andere Kosten denkbar und möglich, so z.B. Umzugskosten.
Wichtig – auch im Hinblick auf (spätere) Prüfungen durch das Finanzamt – ist, dass die Kosten für die Zweitwohnung in der erstatteten Höhe auch tatsächlich angefallen sein sollten und der maximal erstattbare Betrag EUR 1.000 beträgt. Außerdem sollten die mit der monatlichen Lohnabrechnung erstatteten Beträge durch den Arbeitnehmer anhand geeigneter Unterlagen (z.B. Mietvertrag, Kontoauszüge etc.) nachgewiesen und diese zum Lohnkonto übernommen werden.
Achtung:
Für die im Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens erstatteten Mehraufwendungen der doppelten Haushaltsführung trägt der Arbeitgeber die Beweislast gegenüber dem Finanzamt. Es sollte daher auf eine belastbare und für Dritte nachvollziehbare Dokumentation im Lohnkonto geachtet werden, da bei Prüfungen durch das Finanzamt hohe Nachzahlungen sowie darauf entfallende Zinsen drohen.
Was ist vorteilhafter: Ansatz der Mehraufwendungen als Werbungskosten im Rahmen der Einkommensteuererklärung oder Ersatz der Mehraufwendungen durch den Arbeitgeber?
Sofern der Ersatz der Mehraufwendungen der doppelten Haushaltsführung zusätzlich zur ohnehin vereinbarten Vergütung erfolgt, ist diese Option die deutlich vorteilhaftere für den Arbeitnehmer. Dies liegt daran, dass die Steuererstattung, die auf den Ansatz von Werbungskosten im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung entfällt, in folgender Höhe erfolgt:
Grenzsteuersatz x Betrag der Werbungskosten.
Gewöhnlich erhält ein Arbeitnehmer damit etwa 40% seiner Werbungskosten vom Finanzamt zurück — und das im Schnitt frühestens 1 Jahr nach der Zahlung der Werbungskosten.
Beim Ersatz der Mehraufwendungen durch den Arbeitgeber im Rahmen der monatlichen Lohnabrechnung erhält der Arbeitnehmer die von ihm getragenen Mehraufwendungen der doppelten Haushaltsführung mit minimalem Verzug. Der wichtigste Punkt ist jedoch, dass die Erstattung durch den Arbeitgeber in voller Höhe der ihm entstandenen Mehraufwendungen erfolgt bzw. erfolgen kann und damit deutlich höher ist als die Steuererstattung, die er durch das Finanzamt erhalten kann.
Hinweis:
Der Ersatz der Mehraufwendungen der doppelten Haushaltsführung durch den Arbeitgeber sollte im Vorhinein schriftlich im Arbeitsvertrag selbst – oder in einem entsprechenden Zusatz – festgehalten werden.
Was versteht man unter der sog. unechten doppelten Haushaltsführung?
Eine sog. unechte doppelte Haushaltsführung liegt vor, wenn der Steuerpflichtige eine auswärtige Tätigkeit ausübt, jedoch keine Hauptwohnung unterhält. In einer solchen Konstellation konnten in der Vergangenheit — trotz fehlender Hauptwohnung – Werbungskosten (Fahrtkosten, Unterkunft, Verpflegungsmehraufwendungen) am Arbeitsort analog zur doppelten Haushaltsführung in einem Übergangszeitraum geltend gemacht werden. Im Rahmen einer Gesetzesänderung wurde dann der entsprechende Passus so angepasst, dass das Unterhalten einer Hauptwohnung zwingende Voraussetzung zum Abzug der Werbungskosten ist. Die unechte doppelte Haushaltsführung ist damit steuerlich nicht mehr begünstigt.
Wo trägt man die doppelte Haushaltsführung in der Einkommensteuererklärung ein?
Dies hängt davon ab, welcher Einkunftsart die doppelte Haushaltsführung zuzuordnen ist, bedeutet also: Wenn die doppelte Haushaltsführung im Rahmen der Tätigkeit als Arbeitnehmer besteht, ist die doppelte Haushaltsführung in der Anlage N einzutragen. Im Jahr 2020 sind die Eintragungen für die doppelte Haushaltsführung auf Seite 4 der Anlage N vorzunehmen.